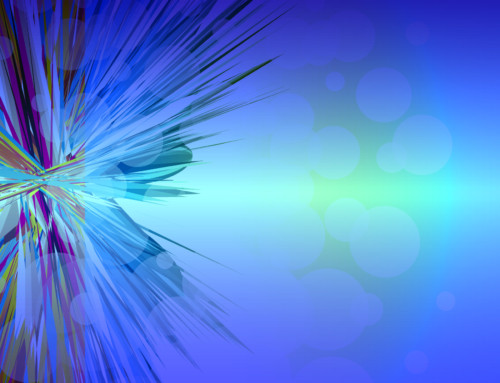Es gibt Menschen, denen es nicht möglich ist, Gott Vater zu nennen. Die Erfahrung mit ihrem leiblichen Vater war zu grausam. Sie wurden so verletzt, dass sie ein Leben lang brauchen, um das Geschehene zu verarbeiten. Und Jesus mutet ihnen das Vaterunser zu: „So sollt ihr beten: Vater …“ Was vielen uns oft zu leicht von den Lippen geht, kann für andere eine Barriere sein, die sie nicht überspringen können. Aber trauen wir Gott nicht zu, dass er diesen Menschen auf andere Weise zeigt, wer er für sie ist? Gott wird trotzdem der Vater bleiben, den Jesus sogar zärtlich Abba nennt, Daddy.
Gottes Selbstoffenbarung „Ich bin der, der für dich da ist“- das ist im glücklichen Fall auch die Beschreibung eines menschlichen Vaters, der seinem Kind Sicherheit und Vertrauen gibt und es in seinem Wachsen begleitet. Es ist uns bewusst, dass wir in Bildern und mit menschlicher Sprache ausdrücken, was eigentlich nicht beschreibbar ist. Aber wir haben die Zuversicht, dass Jesu Erfahrung mit seinem Vater die Richtschnur bleibt, an der wir uns immer wieder neu orientieren können.
„Unser Vater“ hält uns auch als Gemeinschaften zusammen. Jede(r) ist eingeschlossen, niemand ist ausgegrenzt, weil wir alle von einer bedingungslosen Liebe umfangen sind.
Eine Zeitungsnotiz hat mich einmal sehr erschüttert. Es ging um die Zeit, als Nelson Mandela noch im Gefängnis war und die Apartheit in Südafrika wütete. Der Artikel berichtete davon, wie weiße, katholische Ordensfrauen aus Europa den schwarzen Kindern beibrachten, dass sie nur „Vater im Himmel“ beten durften, weil es zwischen weiß und schwarz kein „wir“ und kein „uns“ gab…
Das ist lange her. Oder doch nicht?