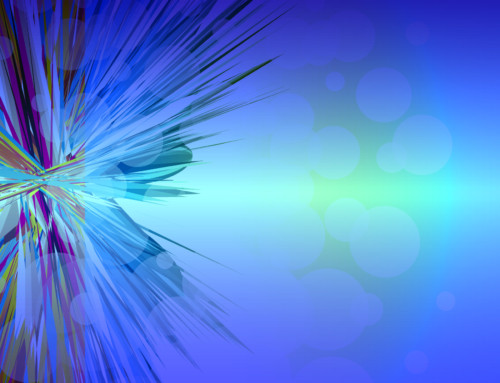Noch bis vor kurzem hatten wir uns so sicher gefühlt bei der Bitte um das tägliche Brot. Wir waren dankbar, dass wir es hatten und dachten mehr an die „armen Länder“ (armgemachte Länder, sagen manche), denen unser Mitgefühl galt. Und von einem Tag auf den anderen waren wir konfrontiert mit der Möglichkeit, dass die Lieferkette auch für uns unterbrochen werden könnte. Die Politiker beruhigten uns – die Regale in den Supermärkten werden immer wieder aufgefüllt – und wir ließen uns beruhigen. Verloren haben wir jedoch die Illusion, dass es so weiter geht wie bisher mit unserem Wirtschaftsboom.
Junge Menschen müssen den Glauben an eine gesicherte Zukunft aufgeben und solche in der Mitte des Lebens sehen lange Familientraditionen, in die sie eingereiht waren, zerbröckeln. Die Bitte um das tägliche Brot wird wieder aktuell, denn viele wissen nicht, wie sie die existentielle Krise für sich und ihre Kinder bestehen können. Dazu kommt die Angst vor dem Virus mit den Einschränkungen, die zunehmend neue Spannungen in den Familien mit sich bringen.
Die Bitte um das tägliche Brot weitet sich aus zur Bitte um alles, was wir zum Leben brauchen: Luft zum Atmen und Weite, Nähe und Verbundenheit, Besuche, Austausch und Feiern, Abwechslung und liebgewordene religiöse Rituale. Unser Leben muss wieder bunt werden, das wünschen wir uns.
Es ist vielen wieder klar geworden, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, so wichtig die Nahrung ist. In diesem Zusammenhang ist es interessant zu hören, dass im Aramäischen, der Muttersprache Jesu, das Wort „Brot“ auch „Einsicht“ bedeutet.
Wie wäre es, wenn wir am Morgen um das bitten, was wir zum Leben brauchen und uns am Abend überlegen: Was ist mir heute aufgegangen? Was habe ich heute eingesehen? So würde sich ein Kreis um uns schließen, der uns einhüllt in die Gedanken Jesu Christi.
Text: Sr. Pietra Hagenberger
Bild von Mandy Fontana auf Pixabay